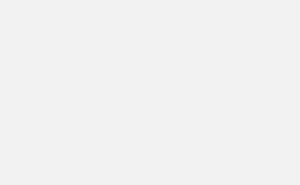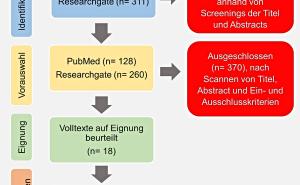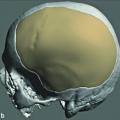NEUROBIOLOGIE VON STRESS, ANGST UND PHSYCHISCHEM TRAUMA - THERAPIEANSÄTZE
Aus der Sektion VI A-Neurologie (Sektionsleiter: Oberfeldarzt Dr. E. Hahn), Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz (Chefarzt: Generalarzt Dr. T. Sohns)
von Wolfgang Weinelt
Zusammenfassung
Humanitäre, friedensschaffende und erhaltende internationale Einsätze führen bei den daran beteiligten Soldatinnen und Soldaten zu atavistisch angelegten, biologischen Spannungsfeldern zwischen Aggression und Flucht und dem Versuch zur Kompensation dieser biologischen Verhaltensmuster unter Erfüllung des Auftrages.
Aus diesem Spannungsfeld resultieren mögliche psychische Reaktionen in Form von Somatisierungsstörungen und anderen psychischen Reaktionen, wie Angst, Stress und akute Belastungsreaktion, und das Risiko der Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS).
In diesem Artikel sollen einerseits neurobiologisch- neurophysiologische Erkenntnisse der verschiedenen Reaktionsmuster und andererseits, auf dem derzeitigen medizinischen Wissen basierend, bekannte Kompensationsmechanismen und mögliche Behandlungsansätze dargestellt werden.
Summary
Neurobiology of stress, anxiety, and psychic trauma - therapeutic options
Humanitarian, peace-keeping and peace-restoring international missions lead to an atavistic, deep-rooted biological divergence between aggression and flight within the soldiers joining the missions, and to a struggle to compensate these biological patterns while in the same time trying to maintain their duties.
Based on this divergence psychological reactions result in the form of somatisation disorders and other psychological reactions like acute stress disorder, anxiety and the risk to develop a post-traumatic stress disorder.
This article deals, on the one hand, with neurobiological- neurophysiologic findings of the different patterns of reaction. On the other hand, based on the actual medical knowledge, known mechanisms of compensation and possible treatments options are displayed.
Neurobiologische Grundlagen von Angst und Stress
In der Ausübung des Soldatenberufes spielen die Vulnerabilität für Angst, Stress und letztlich die Resistenz gegenüber psychischer Verwundbarkeit seit je her eine große Rolle. Während der Krieger vergangener Epochen überwiegend mutig und unerschrocken zu sein hatte, sollte der aufgeklärte, moderne Friedensstifter durch Demonstration von Stärke kämpfen, ohne dabei zu verletzen oder selbst verwundbar zu sein.
Auf die neurobiologische Ebene transformiert bedeutet dies, ständig alarmund kampfbereit zu sein, ohne den aggressiven Impulsen nachzugeben; denn durch die Aggression und den Impulskontrollverlust könnte der übergeordnete Auftrag gefährdet werden: ein Paradigma, das in unserer Biologie eigentlich so nicht angelegt ist. Die Parallelität von zwei gegensätzlichen Impulsen bzw. Intentionen führt auf der Ebene der Verhaltensbiologie häufig zu sogenannten Übersprungshandlungen. Transformiert auf das menschliche Wesen bedeutet dies Folgendes: Wenn weder dem aggressiven Impuls noch der Flucht nachgegangen werden kann, resultiert Stress, der zu somatoformen Störungen und anderen psychischen Reaktionen führen kann.
Im atavistisch-neurobiologischen Sinne dienen Stress und Angst der Arterhaltung, um durch größtmögliche Reaktionsbereitschaft, z. B. im Kampf gegen einen Angreifer, innerhalb kürzester Zeit alle physiologischen Kräfte zu mobilisieren und dadurch die Art zu erhalten.
Durch viele neurophysiologische Untersuchungen in den vergangenen 50 Jahren und Untersuchungen mit Hilfe der Positronenemissionstomographie (PET) sowie der funktionellen Magnet - resonanztomographie (MRT) in den letzten 20 Jahren hat man heute recht genaue Vorstellungen über die Neurophysiologie und Biochemie von Angst und psychischen Traumen.
Neurophysiologie des Stresses
Dabei hat sich z. B. für die Physiologie des Stresses gezeigt, dass die kybernetischen Modelle der Generierung über die Hypothalamus-Hypophysen-Ne ben - nierenrinden-Achse der Komplexität der Sachverhältnisse nicht ausreichend gerecht werden. Während der Exposition gegen chronischen Stress läuft eben nicht nur eine unbewusste hormonale Kaskade ab, sondern die Sinneserfahrung „Stress“ hinterlässt bewusst oder unbewusst Gedächtnisspuren. Diese führen wiederum zu plastischen Veränderungen in Nervennetzwerken des Gehirns, die uns für zukünftige ähnliche Stresssituationen vorbereiten sollen, um noch besser im biologischen Sinne reagieren zu können.
Dabei kommt dem limbischen System im Gehirn des Menschen eine zentrale Rolle für das episodische und semantische Erfahrungs-Langzeitgedächtnis und die Verarbeitung von Emotionen zu. Zu den wichtigsten limbischen Strukturen gehören insbesondere die Amygdala, der Hippocampus, thalamische Regionen, das basale Vorderhirn, der Gyrus cinguli, der Fornix, die Mamillarkörper und der mamillo-thalamische Trakt.
Neurophysiologie der Angst
Es gibt ein Furchtsystem des Gehirns, sozusagen einen neuronalen Schaltkreis der Angst. Ein Reiz stimuliert dabei den sensorischen Thalamus. Im weiteren wird die sensorische Rinde stimuliert, wobei der Thalamus das Tor zum Bewusstsein ist.
Ganz anders sind die Abläufe bei emotionaler Furcht. Hierbei wird das „Abwehrsystem“ über die Amygdala aktiviert. Sie ist die Schaltzentrale der Furcht und zuständig für die Furchtreaktion. Die Amygdala lenkt die Aufmerksamkeit auf emotional motivational wichtige Reize und sorgt für ihre gründliche Verarbeitung durch Erhöhung des kortikalen Erregungsniveaus und wachsames Beobachten der Umwelt. Die Amygdala wird insbesondere durch überraschende, uneindeutige oder ungenaue Situationen aktiviert. Bei dauernder Überaktivierung besteht erhöhte Alarmbereitschaft. Schädigungen der Amygdala führen zu einer Beeinträchtigung der Wahrnehmung und des Erkennens affektiver Informationen. Die Amygdala funktioniert dabei als zentrale Schaltstelle für die Überwachung der Außenwelt auf Gefahrenreize und kann über Projektionen zu verschiedenen subkortikalen Arealen, wie zum Hypothalamus oder zum periaquäduktalen Höhlengrau, spezifische autonome oder endokrine Reaktionen auslösen.
Emotionale Reize können auf zwei Wegen Reaktionen hervorrufen. Einerseits auf dem niederen (kürzeren) vegetativen Weg über den sensorischen Thalamus zur Amygdala und dann zur emotionalen Reaktion. Andererseits erfolgt die Reaktion auf dem höheren Weg der Bewusstwerdung über die sensorische Rinde. Die Amygdala ist eine „Nabe im Rad der Angst“, die im Hippocampus und präfrontalen Kortex supprimiert wird. Die Funktion des Hippocampus besteht in der Abstimmung des Verhaltens auf sich ändernde Kontexte. Der anteriore Cingularkortex (ACC) ist eine Art Überwachungssystem, dass bei Nichtübereinstimmen von Wahrnehmungen, Erwartungen und Zielen oder bei Aktvierung miteinander konkurrierender oder einander ausschließender motivationaler Tendenzen aktiviert wird. Es hat die Aufgabe, zusätzliche Ressourcen zu sichern.
Neurophysiologie der Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS)
PTBS-Symtome, die mit Flash-Backs einher gehen, stehen mit der gedächtnisreorganisierenden Funktion des Hippocampus im Zusammenhang.
Nach dem neurophysiologischen Prinzip ‚Cells that fire together, wire together‘ wachsen Repräsentationszentren zusammen, die immer wieder gleichzeitig aktiviert werden, was unter anderem eine Konditionierung oder Angstgeneralisierung erklären kann. Durch eine solche Verdichtung des neuronalen Netzes und die Zunahme von Assoziationen erklärt man sich unter anderem eine Angstgeneralisierung. Die neuronalen Korrelate der PTBS sind noch komplexer als die der Angst.
Diese Enkodierung von zum Beispiel Gefahrenerlebnissen, die je nach Gefahrensituation von engrammierten Bildern oder unter anderem von Gerüchen geprägt sind, spielt sowohl bei der Stressreaktion als aber auch bei der posttraumatischen Belastungsstörung eine wesentliche Rolle (4).
Es läuft eben nicht nur eine unbewusste hormonale Kaskade ab, sondern die „Sinneserfahrung“ Stress hinterlässt bewusst und unbewusst Gedächtnisspuren, die wiederum zu plastischen Veränderungen in Nervennetzen des Gehirns führen. Dabei wird nicht nur der subjektive Reiz sondern auch die vorherrschende objektive Belegung im Gedächtnis gespeichert. Dies vollzieht sich auf dem Hintergrund bestehender Gedächtnisengramme, die in Teilen durch unterschiedliche Aktivierungen im genetischen Code verankert werden können. Auf diesem Hintergrund wird die Bedeutung von Stressoren und Traumen in der frühen Kindheit deutlich, da diese im neuronalen Netzwerk des emotionalen (impliziten) Gedächtnisses festgehalten werden. Auf dem Hintergrund des genetisch verankerten, impliziten Gedächtnisses ist die These der Weitergabe von Traumaerfahrungen über Generationen nachvollziehbar.
Gleichzeitig beinhaltet dieses Konditionierungsprinzip bzw. „das Lernen von Stress“ die Möglichkeit einer selektiven Extinktion angstbesetzter Inhalte im emotionalen Gedächtnis oder auch der ‚Überschreibung‘ durch positiv besetzte Gedächtnisinhalte. Im psychotherapeutischen Ansatz der Behandlung, nämlich des Wiedererlebenlassens angstbesetzter Situationen in angstfreier und entspannter Umgebung, spielt diese Extinktionsmöglichkeit eine wichtige Rolle. Hierbei wird das Handeln des (autonomen) Ichs unterstützt und gestärkt, um dem phobischen Moment der Hilflosigkeit als vermutlich größten Stressfaktor entgegen zu wirken und den Stressor eigener Hilflosigkeit und Angst aus dem Gedächtnisspeicher löschen zu können.
Gerade die bewusst erlebte Hilflosigkeit – im Sinne des Versagens – des Problem-bewältigenden Ichs bei der posttraumatischen Belastungsstörung setzt dem „bewussten Individuum“ besonders zu. Denn sie ist als biologisches Prinzip in einer biologischen Welt, die vom Angreifen oder von Flucht dominiert ist, nicht vorgesehen. Bedeutet Hilflosigkeit im übertragenen Sinne doch, dass ich als bewusst Seiender meinen wahrscheinlichen Untergang ertragen muss. Das heißt, ich soll zum Beispiel als friedenssichernder Soldat meinen Auftrag auch gegen Aggressivität von außen erfüllen, ohne selbst aggressiv und impulsiv, außerhalb kontrollierter Notwehr handeln zu dürfen und ohne die Möglichkeit der Flucht zu haben, da ich dann in der Erfüllung meines Auftrages versagen würde.
Neurobiochemie der Angst
Mit einer Lebenszeitprävalenz von 18 % handelt es sich bei den Angsterkrankungen um häufige Störungen. Nach ICD 10 bzw. DSM IV-R wird zwischen generalisierter Angststörung, Panikstörung, sozialer Phobie und spezifischer Phobie unterschieden. Man geht bei der Angststörung von einem Ungleichgewicht zwischen der Aktivität im präfrontalen Cortex und der Amygdala aus. Aus neurobiologischer Sicht spielt bei der Regulation von Angst und Panik eine Reihe von miteinander verknüpften Regionen eine Rolle, die als Furchtkreislauf oder Angstnetzwerk bezeichnet werden können. Man vermutet, dass Angstpatienten eine Fehlregulation oder Überempfindlichkeit des Furchtkreislaufes oder Angstnetzwerkes aufweisen. Dabei sind sowohl bewusste als auch unbewusste perzeptive und kognitive Prozesse betroffen.
Bei Patienten mit einer Panikstörung kann die Antizipation von nicht vorhersehbaren und unregelmäßigen Panikattacken dazu beitragen, dass chronische Angst und Vermeidungsverhalten entstehen und aufrecht erhalten werden. Die Antizipation verursacht starke und anhaltende Angst vor erneuten Panikattacken. Die Wahrscheinlichkeit für eine Panikattacke steigt.
Veränderungen des Neurotransmitter- Haushaltes, hier insbesondere des Serotoninsystems, des noradrenergen Systems, des adenosinergen Systems und des GABA-Systems, spielen eine wichtige Rolle. Unter anderem wird eine Fehlfunktion der serotonergen und noradrenergen Kerngebiete mit einer veränderten Freisetzung von Serotonin bei den Angststörungen vermutet. Auch Veränderungen der Serotonin-Rezeptoraktivität werden bei Angststörungen diskutiert. Bei GABA (Gamma-Aminobuttersäure) handelt es sich um den wichtigsten hemmenden Neurotransmitter des Gehirns. Ähnlich wie beim Serotonin geht man sowohl von einer erniedrigten Rezeptorsensivität als auch von Veränderungen der GABAergen Neurotransmission aus. Hier wird eine Verminderung der zentral verfügbaren GABA-Konzentration vermutet. Eine rein linear-kybernetische Betrachtungsweise des zentralen Transmittermangels als Ursache für Angstbereitschaft wird aber der Komplexität des vorliegenden neuronalen Netzwerkes nicht gerecht.
Die Forschungsgruppe von Prof. Pape vom Institut für Physiologie I (Neurophysiologie) am Universitätsklinikum Münster hat die extinktorische Wirkung des ‚Neuropeptid S‘ (NPS) erforscht. Dieses Peptid beeinflusst einen konkreten Bereich der Amygdala, dem Areal des Gehirns, in dem furchtrelevante Erinnerungen gespeichert werden. NPS ist speziell beim Verlernen von übermäßiger Angst von Bedeutung. In einer Studie an Mäusen konnte festgestellt werden, dass nach gezielter Gabe des Peptids in die Amygdala das Angstverhalten enorm reduziert werden konnte. Auch zuvor durch Pawlowsche Furchtkonditionierung erlernte negative Erfahrungen wurden mit dem Neuropeptid wieder schneller verlernt.
Vom Prinzip her funktioniert das Verlernen der übermäßigen Angst folgendermaßen:
Ein zuvor negativ assoziierter Reiz wird mehrmals ohne aversive Folgen präsentiert. Die Furchtantwort bezüglich des Reizes nimmt ab, der Fachbegriff dafür lautet ‚Extinktion‘. Genau das geschieht aber bei traumatisierten Menschen nicht oder nicht vollständig. Im Grunde harmlose Reize können Assoziationen mit der schlimmen Erfahrung auslösen. Ängstliche Reaktionen bis hin zu Panikattacken sind die Folgen für den Betroffenen. Und genau hier könnte der zukünftige Anwendungsbereich des ‚Neuropeptid S‘ liegen.
Bei der Entstehung von Angst sind wahrscheinlich das Neurokinin-1 (NK1)- Rezeptorsystem über die Kalziumkanäle sowie die Hypothalamus-Hypophysen- Nebennierenrinden-Achse beteiligt.
Behandlungsoptionen bei Angststörungen
Bei einigen Therapieformen, wie zum Beispiel der Gabe von Serotonin-Wiederaufnahmehemmern, können Symptome der Angst, unter anderem eine vermehrte innere Unruhe zu Beginn der Behandlung, sogar vermehrt auftreten, was gegebenenfalls eine Begleittherapie durch z. B. Gabe eines Beta-Blockers oder eines Benzodiazepins kurzfristig erforderlich macht. Gerade auch bei Angsterkrankungen sollten Präparate mit möglichst geringen Nebenwirkungen ausgewählt werden. Dies ist notwendig, damit Patienten sich nicht in ihren Befürchtungen bestätigt fühlen, dass sie durch die Einnahme des Medikamentes ‚ruhiggestellt‘ oder die Ängste unterdrückt werden sollen.
Bezüglich der Serotonin-Wiederaufnahmehemmer und der Rezeptoren bloc kade von Alpha 1, Alpha 2, Serotonin, Acetylcholin und Dopamin sowie bezüglich möglicher Effekte an Beta-Rezeptoren bei längerer Anwendung zeigt z. B. Escitalopram ein günstiges Wirkungs-/Nebenwirkungsprofil (1, 2). Eine weitere Behandlungsoption für generalisierte Angststörungen stellt Duloxetin (z. B. Cymbalta® 30 mg) dar. Die Behandlung von vegetativen Begleitsymptomen einer Angststörung können durch nicht kardioselektive Beta-Blocker mit möglichst geringem Nebenwirkungsprofil, wie z. B. Propranolol (40 mg), behandelt werden. Beta-Blocker sind aber bei einer Therapie gemäß der aktuellen Studienlage zur Behandlung der Angst an sich nicht wirksam. Der Einsatz von Benzodiazepinen zur Behandlung von Angststörungen, z. B. mit Lorazepam (0,5 - 0,5 - 0,5 - 1 mg) sollte zeitlich auf 5 bis 10 Tage begrenzt werden.
Es ergeben sich auch Therapieoptionen mit Medikamenten, die zur Behandlung der generalisierten Angststörung zugelassen sind und ein Strukturanalogon der GABA mit modulatorischer Wirkung auf die neuronalen Kaliziumkanäle darstellen. Bei günstigem Wirkungs-/Nebenwirkungsspektrum ist hier Pregabalin (Lyrica®: 75 - 0 - 75 mg) zugelassen.
In Zukunft wird es wahrscheinlich möglich sein, konditionierte Ängste, das heißt sowohl die Alarmreaktion als auch das Angstverhalten, durch Corticotropin- Releasing-Hormon- Antagonisten (entspricht Kortikoliberin), wie zum Beispiel Antalarmin, selbst zu behandeln. Aktuelle Studien zeigen, dass dem „beruhigenden Botenstoff“ Oxytocin, zum Beispiel als Nasenspray verabreicht, eine signifikante, anti-aggressorische, Stress mindernde und vertrauensfördernde, in höheren Dosierungen auch ermattende und entspannende Wirkung zukommt (5).
Auch im Hinblick auf ihre anxiogene Wirkung sind anregende beta-mimetische Substanzen, wie Theophyllin und Koffein, die in Tee und Kaffee enthalten sind, bei bestehenden Angststörungen zu meiden oder ist mit diesen Genussmitteln zurückhaltend umzugehen. Die Behandlung von Angststörungen erfolgt pharmakologisch und psychotherapeutisch.
Ein über die Akuttherapie hinausgehender Einsatz von Benzodiazepinen scheint die Wirksamkeit von kognitiver Verhaltenstherapie durch das Hindern des Erlebens der eigenen souveränen Handlungsweise und damit deren kathartische Wirkung zu behindern. Des Weiteren nehmen Benzodiazepine Einfluss auf die Extinktion von angstbesetzten Inhalten aus dem Gedächtnis.
Aus den neurophysiologisch-biologischen Modellen können auch folgende Schlussfolgerungen für psychotherapeutische Behandlungen gezogen werden:
- Versorgung der Patienten mit möglichst vielen Wahrnehmungen, die einen positiven Wert für seine wichtigsten emotionalen Ziele haben
- Erläuterung des psychotherapeutischen Konzepts im Vorfeld der Psychotherapie
- Kompensation angstassoziierter Situationen durch positive, Angst hemmende Coping-Strategien, zum Beispiel durch Distanzierungstechniken und imaginative Verfahren.
Von entscheidender Bedeutung in der psychotherapeutischen Behandlung von Angst und dem Verarbeiten von traumatischen Erlebnissen ist das ‚autonome‘ Beherrschen und Überwinden von Angstsymptomen im Sinne der Neukonditionierung ohne negativ besetzte affektiv-emotionale Komponenten. Ein wesentlicher psychodynamischer Faktor ist hier das übertragene Zutrauen des Therapeuten in die Handlungsfähigkeit des Betroffenen, bestehende Angstreaktionen selbst zu überwinden.
Posttraumatische Belastungsstörung
Bezüglich der Ätiologie der PTBS gehen aktuelle Studien von einer Dissoziation expliziter und implizierter Gedächtnisinhalte bei Patienten aus. Durch eine Funktionsbeeinträchtigung des Hippocampus ist das explizite traumaspezifische Gedächtnis nicht abrufbar. Dabei geht das implizite traumaspezifische Gedächtnis mit einer Überaktivität der Amygdala einher und entwickelt sich vermutlich aufgrund klassischer Konditionierungsprozesse.
Die neurobiologischen Grundprinzipien von Angst und Stress lassen sich im Wesentlichen auch auf die posttraumatische Belastungsstörung gemäß ICD 10: F 43.1 als anhaltende und die akute Belastungsstörung gemäß ICD 10: F 43.0 als akute Störung übertragen.
Die Wahrscheinlichkeit, nach einem Trauma eine PTBS zu entwickeln, hängt vermutlich unter anderem von der individuellen Vulnerabilität und psychiatrischen Ko-Morbiditäten (z. B. bekannte Major-Depression und Angststörungen) aber auch von genetischen Faktoren (z. B. FL-C64A) ab. Bei Vorliegen des S-Allels des Serotonin-Rezeptorgenotyps erhöht sich das Risiko, eine PTBS zu entwickeln, um das 4,5-fache (3). Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, genau zu prüfen, wer fähig ist, in den Auslandseinsatz zu gehen.
Ein entscheidendes Kriterium für die Bewältigung der traumatisierenden Erfahrung ist die Vorerfahrung. Verleiht diese beispielsweise die innere, meist unbewusste, Gewissheit und den Glauben, einer Herausforderung gewachsen zu sein, beziehungsweise den Stress zu bewältigen oder zumindest kontrollieren zu können, so steigen zum Beispiel die Kortisolwerte nur wenig an.
Bezogen auf Auslandseinsätze von Soldaten sollte berücksichtigt werden, dass die Stresssensitivität gerade dann besonders hoch ist, wenn bereits frühere traumatische Stresserfahrungen vorliegen. Dabei müssen diese Erfahrungen nicht immer bewusst erlebt worden sein. Die Angst- und Stressreaktion kann auch unbewusst ablaufen.
Patienten mit einem posttraumatischen Stresssyndrom reagieren somit ganz besonders stark auf Stress. Dies geschieht zum einen, weil das noradrenerge System des Gehirns gewisser maßen hochgefahren ist, und zum anderen wegen der mangelnden Rückkopplung in der Hypothalamus-Hypophysen- Nebennierenrinden-Achse.
Beim körperlichen oder seelischen Trauma werden noch zahlreiche andere Transmitter und Hormonsysteme aktiviert. Stellvertretend seien hier Opioide und Peptide, wie das Beta-Dynorphin oder Enkephaline, angeführt. Unter Enkephalinen kommt es zu einer Minderung der Stressempfindlichkeit und Angstbereitschaft. Diese Endorphine bekämpfen den Stress. Sie werden unter ausdauernder körperlicher Aktivität vermehrt ausgeschüttet, was den Stellenwert einer Sporttherapie im Rahmen eines multimodalen Behandlungskonzeptes der posttraumatischen Belastungsstörung belegen könnte.
Angstkrankheiten und Phobien entstehen dadurch, dass traumatische Erfahrungen durch Lernprozesse, die Genexpression bestimmter neuronaler Proteine und damit die Struktur neuronaler Netzwerke des Gehirns krankmachend verändern. Vielleicht handelt es sich bei diesen Lernprozessen um die Einsicht Sigmund Freuds, dass jedes Trauma zu einer Verdrängung führt, ja führen muss. Dies bedeutet, dass ein Trauma immer zu einer derartigen Überforderung des Ichs mit schmerzlichen Reizen führt, dass die Seele ökonomischer Weise die Aufarbeitung bzw. die Erledigung des Traumas aufschiebt.
Behandlung der PTBS Es steht heute außer Zweifel, dass die kombinierte pharmakologische und psychotherapeutische Therapie unter Anwendung auch der Eye-Movement- Desensitization and Reprocessing-Technik (EMDR), die Methode der Wahl zur Behandlung von PTBS darstellt. Dabei helfen Medikamente, wie Serotonin- Wiederaufnahmehemmer, eine angstfreie Basis zu bilden, um die Extinktion aus dem impliziten Gedächtnis überhaupt leisten zu können. Eine pharmakologische Extinktion von Gedächtnisinhalten ist zwar prinzipiell möglich. Aber eine solche Vorgehensweise verbietet sich auch aus ethischen Gründen, da sie nicht selektiv auf ein bestimmtes Ereignis anwendbar ist.
Prinzipien der Neurobiologie des Lernens, bei der auch die Verwerfung affektiv nicht belegter Information aus dem verfügbaren Gedächtnis, dem wahrscheinlichen Verdrängen nach Freud, eine entscheidende Rolle spielen, sprechen gegen eine zu frühe Traumatherapie, zum Beispiel noch am Ort des erlebten Traumas. Psychotherapie bedarf eines ruhigen und geschützten Ortes.
Zeitnah zum traumatisierenden Ereignis können allenfalls allgemeine Maßnahmen der Stressreduktion, wie vegetative Stabilisierung, Sicherheit und Geborgenheit schaffen, wirken. Verdrängung bietet erst einmal Schutz vor einer fortwirkenden Bedrohung. Erst in einem sekundären begleitenden Psychotherapieprozess können verdrängte traumatische Erlebnisse durch modifizierte emotional-rationale Bewertung behandelt werden. Der therapeutische Ansatz muss eine reflektierte Neubewertung auch auf affektiv-emotionaler Ebene der früher erlebten und nicht ausreichend bewältigten Situation sein.
Die Kapazität unseres Gedächtnisses ist unbegrenzt. Alle Erinnerungen, denen eine emotionale Bedeutung zugemessen wurde, werden im Gedächtnis abgelegt. Wegen der chaotischen Strukturen der Ablage im Gedächtnis ist der bewusste Zugriff auf den Gedächtnisinhalt jedoch nicht jederzeit möglich, durch Psychotherapie-Techniken aber herstellbar. Psychotherapie von Konflikten und traumatischen Erlebnissen erfolgt also durch Abrufen aus dem Unbewussten und neue emotionale Bewertung, die allerdings vom Patienten und nicht vom Therapeuten erfolgen sollte.
Gemäß der International Consensus Group on Depression and Anxiety werden zur Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung Serotonin- Wiederaufnahmehemmer (unter anderem Escitalopram im Dosisaufbau von z. B. 10 auf 30 mg) und kognitive Verhaltenstherapie empfohlen. Aufgrund von Einzeluntersuchungen könnten auch Substanzen, wie Pregabalin, über die Beeinflussung der Neurotransmitter, insbesondere der Norepinephrine, bei der Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung wirksam sein. Es besitzt bereits eine Zulassung zur Behandlung der generalisierten Angststörung.
Die mit einer PTBS verbundenen Symptome werden, je nach der im Vordergrund stehenden Symptomgruppe, in der Regel wie folgt behandelt:
Bei Fremdaggressivität, depressiver Symptomatik, Zwang und Impulsivität werden Serotonin-Wiederaufnahmehemmer verordnet.
Bei Dissoziationen können Opiat-Antagonisten wie Naltrexon, bei psychotischen und pseudopsychotischer Symptomatik atypische Neuroleptika, sowie bei Angst Antidepressiva verordnet werden (1).
Schlussfolgerungen Aus den Ausführungen wird die biochemische und neurophysiologische Komplexität psychischer Reaktionen auf Stress und psychische Traumen deutlich. Multimodale psychotherapeutische, pharmakologische, sporttherapeutische Therapieansätze sind in der Behandlung effektiver als beispielsweise eine alleinige Traumatherapie mit EMDRTechnik.
Literatur:
- Bandelow B, Zohar J, Hollander E, Kasper S, Möller H: Medikamentöse Behandlung von Angst-, Zwang- und posttraumatischen Belastungsstörungen, Behandlungsleitlinien der World Federation of Societies of Biological Psychiatry; Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft MBH Stuttgart, 2005, 27-50.
- Kasper S, Möller H-J, Müller-Span F: Depression, Diagnose und Pharmakotherapie, 2. Aufl., Thieme Verlag, Stuttgart 2002, 31.
- Kilpatrick DG, Asiano R, Galea B.: Genotype and Social Support and Moderation of Posttraumatic Stress Disorders and Depression in Hurricane Exposed Adults. Am. Psychiatr. 2006; 8(1): 164.
- Piefke M, Markowitsch H-J: Gedächtnis- und Gedächtnisstörungen, Neuroanatomische und Neurofunktionelle Grundlagen, Psychoneuro 2007; 12(33): 522 525.
- Spitzer M: Nervenheilkunde 2009; 2(1): 10
Datum: 20.06.2011
Quelle: Wehrmedizinische Monatsschrift 2011/4